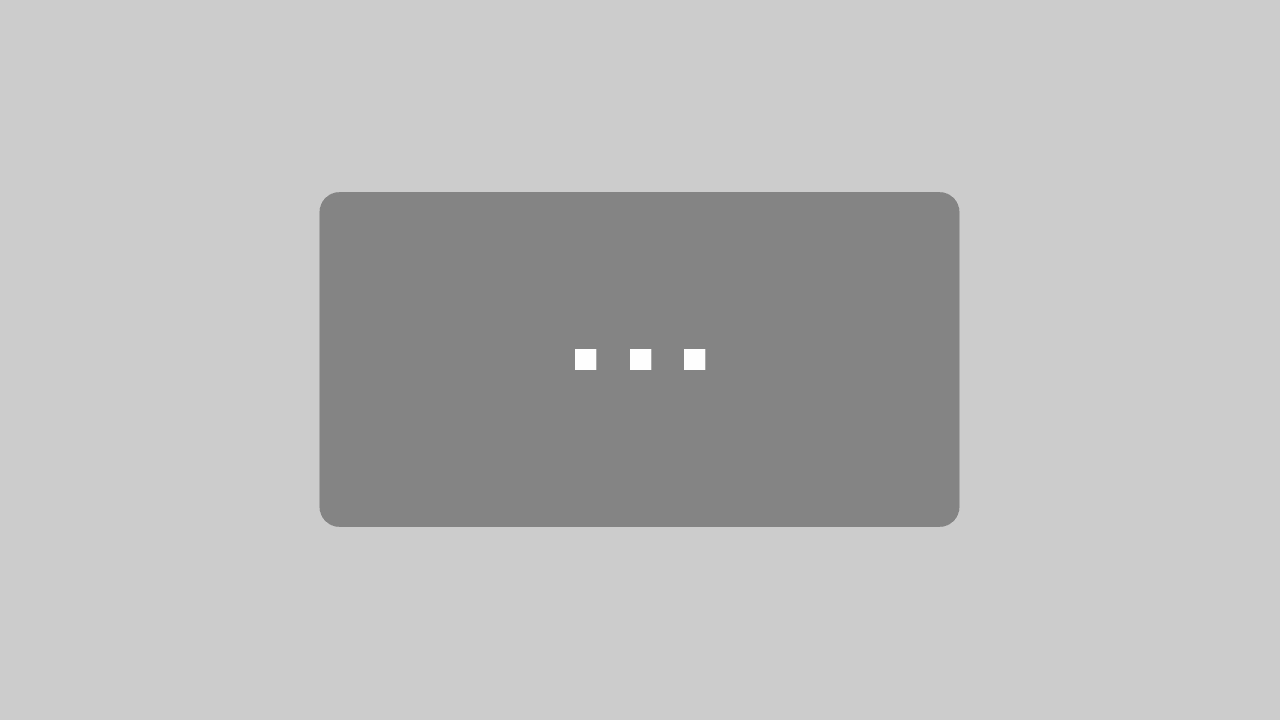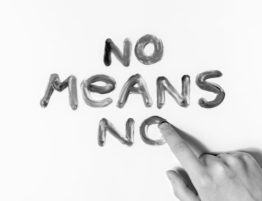Welche Strafe droht bei Wiederbetätigung nach dem Verbotsgesetz?

Das Verbotsgesetz von 1947 wurde in Österreich eingeführt, um jede Form der nationalsozialistischen Wiederbetätigung konsequent zu verfolgen. Der häufigste Fall von Wiederbetätigung tritt auf, wenn über Messenger-Dienste wie WhatsApp, Facebook oder Instagram Bilder versendet werden, die unter das Verbotsgesetz fallen, weil sie Anspielungen auf Adolf Hitler, die NSDAP, oder den Holocaust enthalten.
Verbotsgesetz und nationalsozialistische Wiederbetätigung in Österreich: Was ist strafbar?
Vielen ist nicht bewusst, dass neben offensichtlichen Formen der Wiederbetätigung, wie dem Zeigen des Hitlergrußes, auch das Versenden oder Posten von Bildern mit Bezug zu Adolf Hitler, dem Holocaust oder Organisationen des Dritten Reiches in Österreich nach dem Verbotsgesetz strafbar sein kann. Solche Bilder werden häufig aus „Spaß“ verschickt, wobei der Absender keine nationalsozialistische Gesinnung hat.
Das Versenden solcher Inhalte kann jedoch den Straftatbestand des § 3g des Verbotsgesetzes 1947 erfüllen, welcher besagt:
- Wer sich auf andere als die in den §§ 3a bis 3f bezeichnete Weise im nationalsozialistischen Sinn betätigt, wird, ist mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu fünf Jahren zu bestrafen.
- Wer die Tat auf eine Art und Weise begeht, dass sie vielen Menschen zugänglich wird, ist mit Freiheitsstrafe von einem bis zu zehn Jahren zu bestrafen.
- Bei besonderer Gefährlichkeit des Täters oder der Betätigung, ist der Täter mit einer Freiheitsstrafe von 10 bis 20 Jahren zu bestrafen.
Dieser Paragraph ist ein Auffangtatbestand, der sicherstellen soll, dass jede Form der nationalsozialistischen Wiederbetätigung frühzeitig unterbunden wird. Bereits die Verharmlosung des NS-Regimes oder die Glorifizierung von Adolf Hitler können ausreichen, um strafrechtlich verfolgt zu werden.
Wann liegt eine Wiederbetätigung nach § 3g Verbotsgesetz vor?
Eine nationalsozialistische Wiederbetätigung im Sinne des § 3 g Verbotsgesetzes liegt vor, wenn durch Handlungen, Äußerungen oder Darstellungen die Ziele des Nationalsozialismus propagiert, verharmlost oder glorifiziert werden. Dies kann auf verschiedene Weise geschehen, etwa durch:
- Verharmlosung der nationalsozialistischen Verbrechen, zb das Leugnen oder Relativieren des Holocust.
- Glorifizierung Adolf Hitlers oder seines „Lebenswerkes“ oder anderer NS-Persönlichkeiten.
- Verunglimpfung von Widerstandskämpfern.
- Die unsachliche, einseitige oder propagandistische Darstellungen nationalsozialistischer Maßnahmen und Ziele.
Für eine Strafbarkeit nach § 3g Verbotsgesetz ist Vorsatz erforderlich. Das bedeutet, der Täter muss die Verwirklichung des Tatbestands zumindest ernsthaft für möglich halten und findet sich mit diesem Risiko ab. Dieser sogenannte „bedingte Vorsatz“ genügt bereits für eine Verurteilung.
Laut ständiger Rechtsprechung reicht es für die Annahme des bedingten Vorsatzes nicht aus, wenn man bloß feststellen kann, dass der Täter um die Tatbestandsverwirklichung hätte wissen müssen oder können, oder hätte mit ihr rechnen müssen (RIS-Justiz RS0089257). Er muss die Verwirklichung des Tatbestandes ernstlich für möglich halten und sich damit abfinden. Wenn der Täter die Verwirklichung des Tatbildes noch nicht einmal für möglich hält, erkennt er das Risiko nicht und handelt somit ohne Vorsatz.
§ 3h Verbotsgesetz: Holocaust-Leugnung und -Verharmlosung
Zusätzlich zu § 3g regelt § 3h des Verbotsgesetzes die Strafbarkeit der Holocaust-Leugnung oder -Verharmlosung:
- Wer öffentlich den nationalsozialistischen Völkermord oder andere Verbrechen gegen die Menschlichkeit leugnet, verharmlost, gutheißt oder zu rechtfertigen sucht, ist mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu fünf Jahren zu bestrafen.“
- Wenn die Tat über ein Medium, wie Druckwerk oder auf eine Weise begangen wird, die vielen Menschen zugänglich ist, drohen Freiheitsstrafen von einem bis zu zehn Jahren. Besonders gefährliche Täter können mit bis zu 20 Jahren Haft bestraft werden. Seit dem 01.01.2024 gilt jede Form der Verharmlosung als strafbar, selbst vermeintlich harmlose „Witze“ über Opfer des Nationalsozialismus.
Seit dem 01.01.2024 gilt jede Form der Verharmlosung des Holocaust als strafbar – selbst vermeintlich harmlose Witze über Opfer des Nationalsozialismus. Nach ständiger Rechtsprechung des Obersten Gerichtshofes ist die organisierte Massentötung (überwiegend) von Menschen jüdischer Abstammung eine historische Tatsache im Range zeitgeschichtlicher Notorietät, die als solche keiner beweismäßigen Widerlegung zugänglich ist (RIS-Justiz RS0080038). Das bedeutet, diese Verbrechen der Nationalsozialisten sind eine unbestreitbare Tatsache.
Achtung, Verschärfung des Verbotsgesetz, nun droht Amtsverlust für Beamte und Vertragsbedienstete!
Seit dem 01.01.2024 verlieren Beamte und Vertragsbedienstete von Bund, Ländern oder Gemeinden automatisch ihr Amt oder ihre Anstellung, wenn sie nach dem Verbotsgesetz verurteilt werden.
Wie erlangen die Behörden Kenntnis davon?
Die Polizei wird oft durch Anzeigen dritter Personen oder die Untersuchung von Geräten auf solche Inhalte aufmerksam. Häufig entdeckt sie diese im Zuge anderer Ermittlungen, beispielsweise bei Hausdurchsuchungen wegen Suchtgifthandels. In solchen Fällen werden Mobiltelefone und Computer beschlagnahmt und auf NS-bezogene Inhalte überprüft.
In Österreich ist nicht nur das Versenden solcher Bilder in Gruppen oder das Posten in sozialen Medien strafbar ist, sondern auch das private Versenden solcher Bilder als Privatnachrichten, an Freunde.
Beispiele aus der Rechtsprechung, in welchen Personen nach § 3g Verbotsgesetz bestraft wurden:
Gerichte in Österreich haben zahlreiche Fälle entschieden, die verdeutlichen, wie breit das Spektrum der strafbaren Handlungen ist. Zu den häufigsten Fällen zählen:
- Versenden von Bildern mit NS-Bezug:
- Bilder von Adolf Hitler mit Texten wie „Du bist lustig, dich vergas ich zuletzt“.
- Abbildungen von Konzentrationslagern mit der Aufschrift „Familien im Brennpunkt 1939-1945“.
- Posten von NS-Symbolik in sozialen Medien:
- Das Teilen von Bildern oder Videos mit Hitlergruß.
- Die Verbreitung von Hakenkreuzen oder anderen Symbolen des NS-Regimes.
- Glorifizierung Adolf Hitlers:
- Das Feiern seines Geburtstags (20. April) durch NS-bezogene Beiträge, z. B. das Posten von Bildern mit Eiernockerln.
- Holocaust-Leugnung oder -Verharmlosung:
- Öffentliche Äußerungen, die den Holocaust als „Erfindung“ bezeichnen.
- Relativierung der Opferzahlen oder Verharmlosung der Gräueltaten.
Verwaltungsrechtliche Konsequenzen
Auch ohne strafrechtliche Verurteilung können Verstöße verwaltungsrechtlich nach Art. 3 Abs. 1 Ziff. 4 EGVG mit einer Geldstrafe von bis zu € 20.000,00 oder Freiheitsstrafe von bis zu sechs Wochen geahndet werden, wenn der Eindruck entsteht, dass nationalsozialistisches Gedankengut verbreitet wird. Hierfür genügt bereits Fahrlässigkeit, ein Vorsatz ist nicht erforderlich.
Wann ist das Versenden von solchen Bildern nach dem Verbotsgesetz nicht strafbar?
Eine Ausnahme besteht nur, wenn die Bilder eindeutig die Gegnerschaft zum Nationalsozialismus ausdrücken, etwa bei Satire oder historischer Aufarbeitung. Auch das Versenden historischer Dokumentationen oder Bilder ist in der Regel nicht strafbar.
Wann ist der Besitz von NS-Devotionalien nicht strafbar?
Laut Rechtsprechung (OGH 11 Os 48/02 und 15 Os 49/04) ist der bloße Besitz von NS-Propagandamaterialien ohne Absicht der Wiederbetätigung nicht strafbar. Allerdings darf dieses Material nicht öffentlich ausgestellt werden. Das „Ansammeln“ von NS-Propagandamaterial mit Wiederbetätigungstendenz ist jedoch strafbar.
Wie kann ich Sie verteidigen?
Wenn Sie einer Straftat nach dem Verbotsgesetz beschuldigt werden, ist es wichtig, keine Aussage ohne rechtlichen Beistand zu machen. Die Abgrenzung zwischen strafbarer Wiederbetätigung und verfassungsrechtlich geschützter Meinungsfreiheit kann schwierig sein. Ich als erfahrener Anwalt werde gemeinsam mit Ihnen eine Verteidigungsstrategie entwickeln und prüfen, ob überhaupt ein strafbares Verhalten vorliegt. Seit 01.01.2024 ist es zudem möglich, in bestimmten Fällen eine Diversion zu beantragen, wodurch eine gerichtliche Verurteilung vermieden werden kann.
Wichtiger Hinweis bei einer Hausdurchsuchung
Bei einer Hausdurchsuchung müssen Sie keine Passwörter oder Zugangscodes preisgeben. Technisch ist es möglich, dass Behörden Ihre Geräte entschlüsseln, was jedoch mehrere Monate dauern kann.
Artikel teilen:
Dieser Artikel soll lediglich eine kurze Übersicht darstellen und ist ohne Gewähr. Sofern Sie weitere Fragen haben, können Sie mich gerne jederzeit während meinen Kanzleizeiten telefonisch kontaktieren.
Mag. Sascha Flatz, Ihr Rechtsanwalt für Strafsachen in 1010 Wien.
- Mail: office@rechtsanwalt-flatz.at
- Tel: +43 1 402 6467
- Web: www.rechtsanwalt-flatz.at